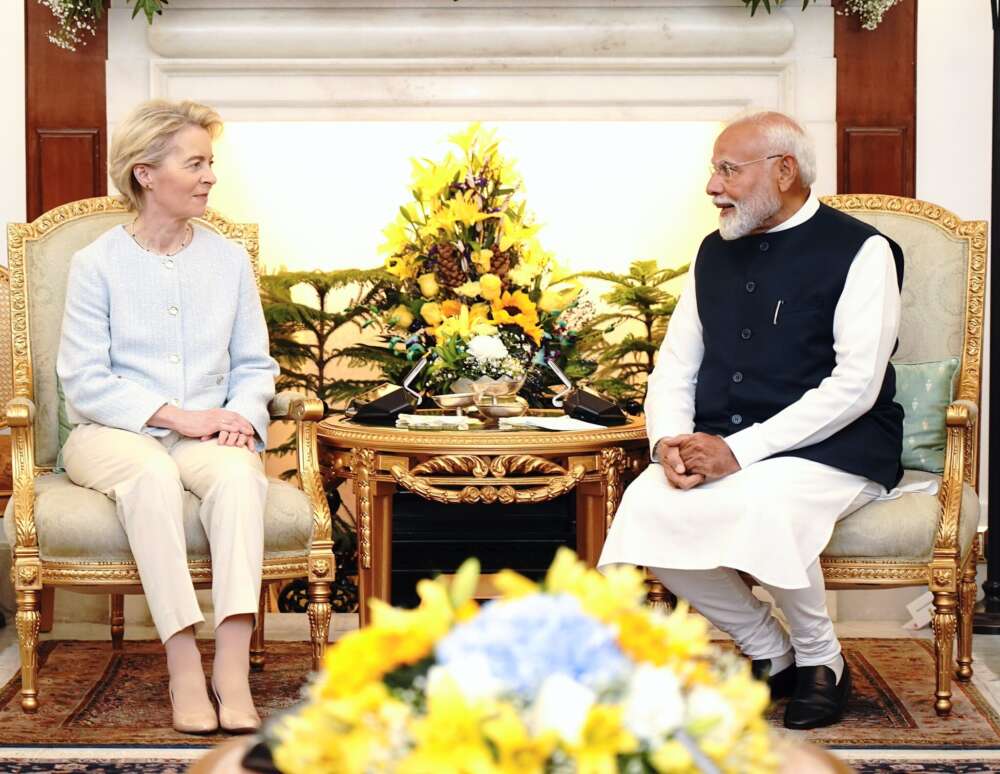Der China-Schock droht die deutschen Kernindustrien zu verwüsten

Der China-Schock ist Realität. Im laufenden Jahr steuert Deutschland auf ein Rekord-Handelsdefizit mit China von rund 87 Milliarden Euro zu – 20 Milliarden mehr als noch 2024. Exporte nach China sind im freien Fall. Die deutsche Wirtschaft exportiert mittlerweile mehr in die USA, nach Frankreich, in die Niederlande, nach Polen und nach Italien.
Die Aussichten für deutsche Kernindustrien wie Maschinenbau, Chemie und Automobil sind düster. Im Maschinenbau etwa nehmen chinesische Importe massiv zu. Preisvorteile chinesischer Anbieter von oft bis zu 30 Prozent setzen deutsche Firmen unter massiven Wettbewerbsdruck, gespeist aus niedrigeren Produktionskosten, staatlicher Subventionspolitik und dem gezielten Wechselkursmanagement Pekings. Erstmals ist Deutschland im Schlüsselbereich Kapitalgüter insgesamt gegenüber China ins Defizit geraten.
Noch exportiert die deutsche Autoindustrie noch mehr Luxus-Verbrenner nach China als umgekehrt. Doch nur blinde Manager glauben, dass dies von Dauer ist. Lange Zeit war China Nettoimporteur bei Automobilen. Jetzt ist das Land Exportweltmeister: 2024 exportierte China 6,4 Millionen Fahrzeuge, 2025 wird ein weiterer Zuwachs erwartet. Bis 2026 könnten es acht Millionen Fahrzeuge sein.
Zum Vergleich: Deutschland exportierte 2016 auf dem Höhepunkt rund 4,4 Millionen Pkw, heute nur noch etwa 3,2 Millionen, mit deutlich fallender Tendenz. Die chinesische Dominanz bei Elektrofahrzeugen zeichnet ein klares Bild der Zukunft – die deutsche Autoindustrie gerät zunehmend auf Drittmärkten, in China selbst und ohne Umsteuern auch auf dem europäischen Heimatmarkt ins Hintertreffen.
Vor zwei Jahrzehnten ging der erste China-Schock an Deutschland noch vorbei. Damals verwüsteten chinesische Importe die traditionellen Industrien in den USA, beschrieben in J. D. Vances Bestseller „Hillbilly Elegy“. Heute trifft ein noch weit heftigerer China-Schock Deutschland frontal. Mehr „China-Schock hoch zwei“ als „China-Schock 2.0“. Daniel Rosen von der Rhodium Group spricht schon von einer „Hillbilly Elegy mit deutschen Charakteristika“.
Erste Vorboten sind dramatische Gewerbesteuereinbrüche, gerade im Süden, 80 Prozent allein in Ditzingen, dem Sitz des Maschinenbauers Trumpf. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt zeigen sich die Folgen ebenso deutlich: Seit 2019 sind rund 245.000 Industriearbeitsplätze verloren gegangen, weitere Hunderttausende sind akut gefährdet.
Wir können nicht erwarten, dass China freiwillig seinen industriepolitischen Kurs ändert. Vizekanzler Lars Klingbeil adressierte diese Woche in Peking zwar offen die staatlich geförderten Wettbewerbsverzerrungen – doch ein Politikwechsel ist unwahrscheinlich.
Beim jüngsten „Stockholm China Forum“ des German Marshall Fund in Seoul waren sich chinesische und westliche Experten einig: Pekings neuer Fünfjahresplan strebt eine für die Konfrontation mit den USA gehärtete Volkswirtschaft an, technologisch unabhängig vom Rest der Welt und industriell dominant auf globalen Märkten.
Für Europa bleibt die Rolle des Zulieferers
Für Europa bleibt in Pekings Vision die Rolle eines Zulieferers von Lebensmitteln, der seine Märkte für chinesische Produkte und Investitionen offen hält. Premier Li Qiang speiste Olaf Scholz bereits 2024 mit Handelserleichterungen für Äpfel und Rindfleisch ab und den Worten: „Moderate Überkapazitäten fördern den Wettbewerb und sichern das Überleben der Stärkeren.“ Die Botschaft ist klar: Der Schwächere, also Europa, muss in Pekings staatskapitalistisch-darwinistischer Logik industriell sterben.
Um dies abzuwenden, müssen Deutschland und Europa dringend umsteuern. Kanzler Friedrich Merz sprach zuletzt nach dem Stahlgipfel Klartext: Die Zeiten offener Märkte und fairen Wettbewerbs seien vorbei, Deutschland müsse sich schützen. Doch bloße Defensive reicht nicht aus, insbesondere nicht der alleinige Schutz alter Industrien. Deutschland muss nichts weniger als sein Wirtschaftsmodell neu aufstellen.
Dafür braucht es eine kluge Kombination aus gezieltem Handelsschutz auf EU-Ebene, einer wirksamen Energiepolitik, massiven Investitionen in Qualifizierung und Transformation in den Industrieregionen, Stärkung von Binnennachfrage und EU-Binnenmarkt sowie globaler Kooperation mit Partnern zum Schutz vor Chinas Industriepolitik und Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen. Kurz gesagt: Deutschland braucht eine robuste Industriepolitik, die schützt und technologisch aufholt, mit dem Hunger auf Innovation, der heute nicht zuletzt China auszeichnet.
Andernfalls heißt der Bestseller in einigen Jahren tatsächlich: „Hillbilly Elegy im Schwabenland“.
Dieser Kommentar wurde erstmals am 19. November im Handelsblatt veröffentlicht.