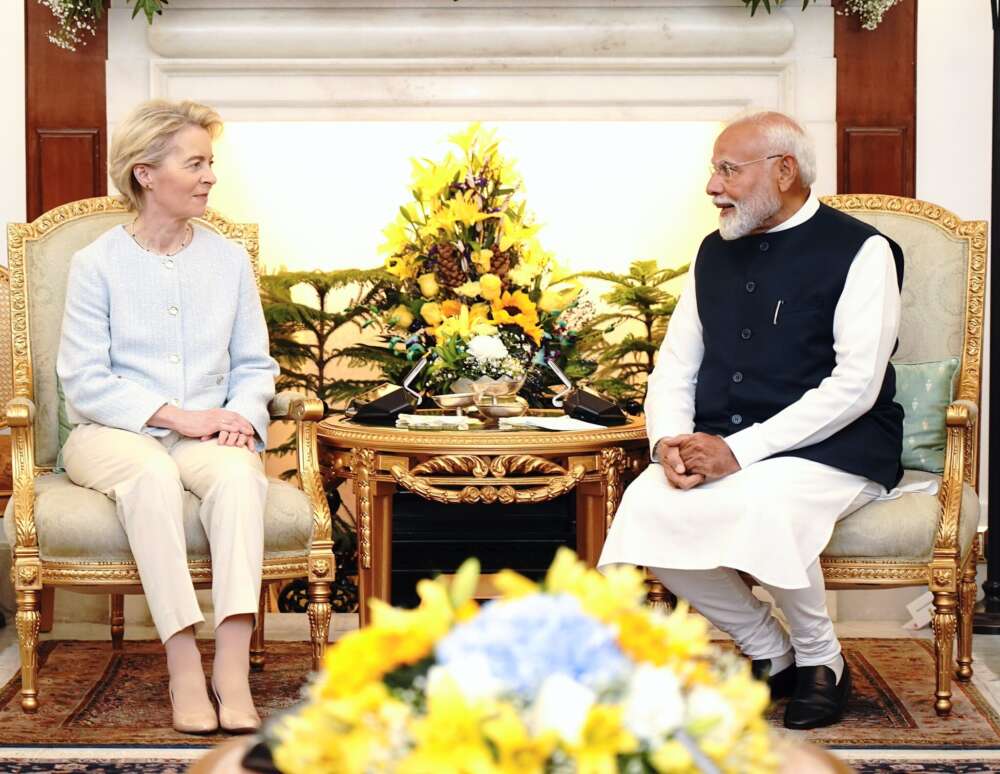China-Schock: Deutschland muss sich selbst behaupten
Wir stehen vor einem chinapolitischen Totalschaden, der den Kern deutscher und europäischer Sicherheit und Wohlstand bedroht. Unsere fahrlässig eingegangenen Abhängigkeiten bei Lieferketten und kritischen Rohstoffen geben Peking einen An- und Ausschalter für zentrale Bereiche der Industrieproduktion.
Wir haben unsere Medikamentenversorgung und Rüstungsindustrie in die Hände Chinas gelegt. Gleichzeitig verlieren Deutschlands Kernindustrien von Automobil über Maschinenbau bis Chemie massiv Marktanteile gegenüber chinesischen Wettbewerbern nicht nur auf dem chinesischen Markt und Drittmärkten, sondern zunehmend auch auf dem europäischen Heimatmarkt.
Durch den China-Schock droht die industrielle Entkernung eines bereits durch Regulierungswust, hohe Arbeits- und Energiekosten sowie bestehende Hürden im Binnenmarkt geschwächten Deutschlands und Europas.
Trumps Zölle schaden Deutschlands Industrie. Doch Jacob Helberg, von Trump ernannter Staatssekretär für Wirtschaft im US-Außenministerium, liegt sehr richtig damit, dass nicht die USA, sondern China die zentrale Herausforderung für die industrielle Basis Europas sei.
Das Problem ist dabei keinesfalls, dass der Außenminister seine Reise nach Peking kurzfristig abgesagt hat, nachdem die chinesischen Gastgeber deutsche Positionsveränderungen zur Vorbedingung für Gespräche machten.
Die Absage ist so bedauerlich wie notwendig. Ja, jede Möglichkeit für Diplomatie und Gespräche mit China sollte gerade in Zeiten großer Interessenkonflikte genutzt werden. Doch nicht zu jedem Preis. Zu Gesprächsbereitschaft und Diplomatie gehören immer zwei Seiten. Ein deutscher Außenminister kann sich von chinesischer Seite nicht die vermeintlich „korrekten“ Positionen diktieren lassen etwa gegenüber Taiwan oder Chinas aggressivem Gebaren in seiner Nachbarschaft.
Es gilt: Besser später reisen als falsch reisen. Das sieht nicht nur Bundeskanzler Friedrich Merz so, mit dem der Außenminister die Verschiebung des Besuchs eng koordiniert hat. Dirk Wiese, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, konstatiert: „Ein Besuch ergibt nur Sinn, wenn die Gespräche gleichberechtigt und inhaltlich offen stattfinden. Diese Voraussetzungen scheinen derzeit nicht gegeben“. Auch Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen-Bundestagfraktion, unterstützt Wadephuls Entscheidung als „folgerichtig und konsequent“.
Wiese und Brugger haben verstanden: die Zeiten sind zu ernst, um Chinapolitik für kurzfristige parteipolitische Profilierung zu nutzen. Gegenüber Erpressungsversuchen eines mit entschlossener Machtpolitik agierenden chinesischen Parteistaats braucht es bei allem notwendigen öffentlichen Ringen um den richtigen Kurs Geschlossenheit. Wenn Peking mit seinen Methoden Erfolg hat, ist das Resultat keinesfalls eine „Stabilisierung“ der Beziehungen, sondern eine Ausweitung der Erpressung, um mehr Zugeständnisse zu erreichen. Peking folgt in bester leninistischer Tradition der Formel „Mit Bajonetten stochern: findet ihr Brei, stoßt vor. Findet ihr Stahl, zieht euch zurück“.
Grundlage der seit Langem für Mitte November geplanten Reise von Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil nach Peking muss eine nüchterne Betrachtung des Scheiterns auf ganzer Linie der deutschen Chinapolitik der letzten beiden Jahrzehnte sein. Und ein klares Verständnis, wie sich Deutschland gegenüber Peking gemeinsam mit Partnern in Europa und weltweit härten kann, um im Systemwettbewerb mit dem autoritären Staatskapitalismus bestehen zu können.
Deutschland muss die notwendigen chinapolitischen Hausaufgaben schnell angehen angesichts des drohenden China-Schocks für deutsche Kernindustrien und der Ausübung wirtschaftlichen Zwangs durch Peking. Ob die deutsche Chinapolitik wirksam ist, entscheidet sich nicht primär durch Reisen nach China, sondern dadurch, ob Deutschland daheim und mit Partnern in Europa das Nötige tut: Gegenmacht gegen Peking organiseren, Schutzmaßnahmen ergreifen und die Basis dafür zu legen, kritische Abhängigkeiten radikal zu reduzieren und entschlossen in den Wiederaufbau eigener Stärke investieren.
Dafür muss Deutschland auch bereit sein, kurzfristige Kosten in Kauf zu nehmen, politisch wie wirtschaftlich, sonst werden die Folgekosten des Nichthandeln unkalkulierbar hoch.
Ursachen des Scheiterns
Bequemlichkeit, Arroganz und Priorisierung kurzfristiger Profitinteressen haben uns in die Situation von Abhängigkeiten und Schutzlosigkeit gegenüber den Methoden des autoritären Staatskapitalismus manövriert. Es ist ein kollektives deutsches Elitenversagen gigantischen Ausmaßes.
Peking darf man dabei keine Vorwürfe machen. Die chinesische Regierung hat ihre Absichten immer transparent kommuniziert. In einer Rede im April 2020 sagte Xi Jinping sehr klar, dass man in allen sicherheitsrelevanten Bereichen der Produktion vom Ausland unabhängig werden wolle. Gleichzeitig müsse man die „Abhängigkeit internationaler Produktionsketten von China erhöhen“.
Kurz danach wurde ein Vertreter eines an kritischen Rohstoffen reichen Partners Deutschlands in Wolfsburg vorstellig mit der Idee, Volkswagen solle aus wohlverstandenem Eigeninteresse in Förderung und Verarbeitung von kritischen Rohstoffen investieren, um die Abhängigkeiten von Lieferungen aus China zu verringern. Interesse: Null.
Zu fernliegend schien den Volkswagen-Managern, Zeit und Geld in die Hand zu nehmen, um vermeintlich abseits des Kerngeschäfts in die Sicherung von Lieferketten investieren. Volkswagen ist kein Einzelfall. Der gesamte Westen hat bereitwillig das dreckige Geschäft mit geringen Margen bei seltenen Erden und kritischen Rohstoffen an China ausgelagert.
Dabei hatte Peking bereits 2010 gegenüber Japan demonstriert, dass man nicht zögert, Abhängigkeiten bei seltenen Erden in außenpolitischen Konfliktfällen als Waffe einzusetzen. Pekings umfassendes Exportkontrollregime bei seltenen Erden und kritischen Technologien, das es nach Verhandlungen mit US-Präsident Trump für ein Jahr ausgesetzt hat, ist die Weiterentwicklung von seit langem angelegten Ambitionen.
Ebenso transparent hat Peking seit mehr als einem Jahrzehnt die Absicht kommuniziert, die deutsche Industrie in ihren Kernbereichen von ihrer Stellung auf dem Weltmarkt zu verdrängen. Die 2015 veröffentlichte „Made in China 2025“-Strategie detaillierte den Masterplan für den Aufstieg zur dominanten Industriemacht.
Die führende chinapolitische Denkfabrik Merics sprach damals von einer „Kampfansage an Deutschland“. Eine ausführliche Merics-Studie machte klar, dass Deutschlands Industrie in ihrem Kern bedroht würde durch die chinesischen Ambitionen. Auf der von Merics erstellten „Heat Map“ von Pekings Ambitionen fand sich Deutschland im tiefroten Bereich. Ernst genommen haben viele deutsche Industriekapitäne und Politiker die Gefahr nicht. Zu erfolgreich war die deutsche Industrie im letzten goldenen Jahrzehnt des deutschen Models.
Und zu tief der Glaube, dass die deutsche Industrie sich in den letzten acht Jahrzehnten immer erfolgreich gegen Konkurrenz auf dem Weltmarkt behauptet hat und gestärkt aus dem Wettbewerb hervorgegangen ist. Warum sollte es mit China anders sein als mit Japan und Südkorea, argumentierte etwa Bundeskanzler Olaf Scholz während seiner Amtszeit.
Das historische Beispiel der deutschen Solarindustrie, dessen Geschäft fast komplett nach China abwanderte, ignorierte Scholz geflissentlich. Und selbst wer unter den Dax-Vorständen die langfristige Gefahr sah, der entschied sich doch meist für die kurzfristigen Mitnahmeeffekte der Profite auf dem chinesischen Markt, solange diese noch sprudelten. Es ist nicht zufällig, dass Familienunternehmer zu den ersten gehörten, welche die Alarmglocken läuteten und dem BDI die notwendige politische Unterstützung innerhalb des Verbands für das wegweisende Grundsatzpapier aus dem Jahr 2019 zu China als „systemischem Wettbewerber“ sicherten.
Heute ist der China-Schock in vollem Gange. Und doch verschließen wir in der öffentlichen Debatte weiterhin die Augen davor und schieben die industrielle Schwäche Deutschlands allein auf hohe Energie- und Lohnkosten, Überregulierung und Trumps Zölle.
Dabei ist die Beweislage untrüglich: Die Exporte nach China brechen dramatisch ein, die Importe steigen unaufhaltsam. Auf Drittmärkten verlieren deutsche Unternehmen drastisch Marktanteile gegen chinesische Konkurrenz. Seit 2019 hat Deutschland 217.000 Industriearbeitsplätze verloren. Weitere hunderttausende gut bezahlte Arbeitsplätze drohen wegzubrechen, gerade in der Automobilindustrie.
Und doch tut die deutsche Automobilindustrie noch so, als könne man weiter auf offene Märkte setzen und politisch auf eine naive Partnerschaft mit Peking. Zu groß ist die kurzfristige Sorge um den Export der letzten Benziner-Luxuskarossen nach China sowie das Interesse am Import von in eigenen chinesischen Werken produzierten Elektrofahrzeuge nach Europa.
Investitionen in Systemwettbewerbsfähgigkeit
Exportweltmeister in einer Welt offener Märkte zu sein, ist eine Vision, die in Zeiten von Xi und Trump die Grundlage in der Realität verloren hat. Noch mehr als Trump zwingt China uns dazu, unser Wirtschaftsmodell zu überdenken. So nötig sie sind: Senkung von Energie- und Lohnnebenkosten sowie Abschaffung unnötiger Regulierungen werden allein nicht ausreichen, um systemwettbewerbsfähig zu werden.
Zusätzlich nötig sind Maßnahmen zur radikalen Reduzierung von Abhängigkeiten, Aufbau eigener Hebel, Schutz von Kernindustrien sowie Investitionen in neue Stärke. Die Ironie ist dabei: Chinas autoritärer Staatskapitalismus zwingt uns Staatsintervention auf, um uns aus dem Würgegriff Pekings zu befreien und unsere Industrien zu schützen.
Neue Anbieter von kritischen Rohstoffen entstehen angesichts von Pekings Markt- und Preismacht nur, wenn staatliche Rahmensetzung Nachfrage garantiert. Und nur wenn unsere Gesundheitssysteme höhere Preise für Medikamente zu zahlen bereit sind, können wir uns von den Abhängigkeiten aus der chinesischen Produktion lösen. Staatliche Eingriffe sind zudem nötig, um zu verhindern, dass weitere deutsche Kernindustrien den Weg der Solarindustrie gehen und gegen die chinesische Konkurrenz vom Markt verschwinden.
Es ist Beweis ewiggestrigen Denkens, wenn man solche Maßnahmen wie Eberhard Sandschneider als Blockade des nötigen Wettbewerbs mit China „durch Protektionismus und eine zunehmend transaktionale Außen- und Wirtschaftspolitik“ zu brandmarken versucht. Denken à la Sandschneider hat uns erst in diese prekäre Situation gebracht, in der wir Wohlstand und Verteidigungsfähigkeit durch eine fahrlässige Chinapolitik aufs Spiel gesetzt haben.
Dabei hat Sandschneider durchaus recht, dass auch China in manchen Bereichen von Deutschland und Europa abhängig ist. Aber er geht naiverweise davon aus, dass daraus einfach so gemeinsamer wirtschaftlicher Erfolg entsteht. Stattdessen geht es darum, Chinas Abhängigkeiten durch Investitionen in „strategische Unverzichtbarkeit“ zu fördern, wie es BDI-Chef Peter Leibinger vorschlägt.
Zudem müssen wir diese Abhängigkeiten auch politisch nutzbar machen, wie Tobias Gehrke und Janka Oertel jüngst in einem sehr lesenswerten Stück ausgeführt haben. Aus dieser Position lässt sich dann selbstbewusster der Dialog mit Peking zu strittigen Fragen suchen. Peking nimmt Berlin aktuell offenbar wenig ernst und sieht Deutschland und Europa in einer Position der Schwäche.
Deshalb versucht Peking, die Daumenschrauben politisch immer weiter anzuziehen und etwa „Korrekturen“ an der Ein-China-Politik zu erzwingen. Wenn klar ist, dass Deutschland Gegenmacht mit zu organisieren bereit ist dafür auch Kosten in Kauf nimmt und Risiken, dann kommen wir auch wieder in eine bessere Position, Kompromisse zu verhandeln. Gleichzeitig sollte Deutschland massiv in Vertiefung des Binnenmarktes und Wiedergewinnung eigener Innovationsfähigkeit investieren – und von China insofern lernen, dass wir wieder einen Hunger auf die Gestaltung von Zukunft entwickeln und aus einer rein defensiven und defätistischen Haltung hinausfinden.
Bei alledem bringt es wenig, auf belehrende Rhetorik gegenüber Peking zu setzen. Doch eine realistische Chinapolitik beginnt mit einer realistischen Beschreibung der Realität. Dazu gehört, dass China wichtigster Unterstützer von Moskau Militärmaschinerie ist und Europas Sicherheit somit direkt bedroht. Dazu gehört auch, dass China aggressiv gegenüber Taiwan und anderen Nachbarstaaten auftritt.
Wer wie Sandschneider Wadephuls Aussage, China „ignoriere das Seevölkerrecht im südchinesischen Meer“ als „unnötige Provokation Chinas und strategisch unklug“ brandmarkt, redet nicht einer realistischen Interessenpolitik, sondern der Unterwerfung das Wort.
Peking muss in Deutschland und Europa auf mehr Stahl und weniger Brei stoßen. Und auf Lust auf Zukunft.
Dieser Kommentar wurde ursprünglich am 3. November 2025 von The Pioneer veröffentlicht.