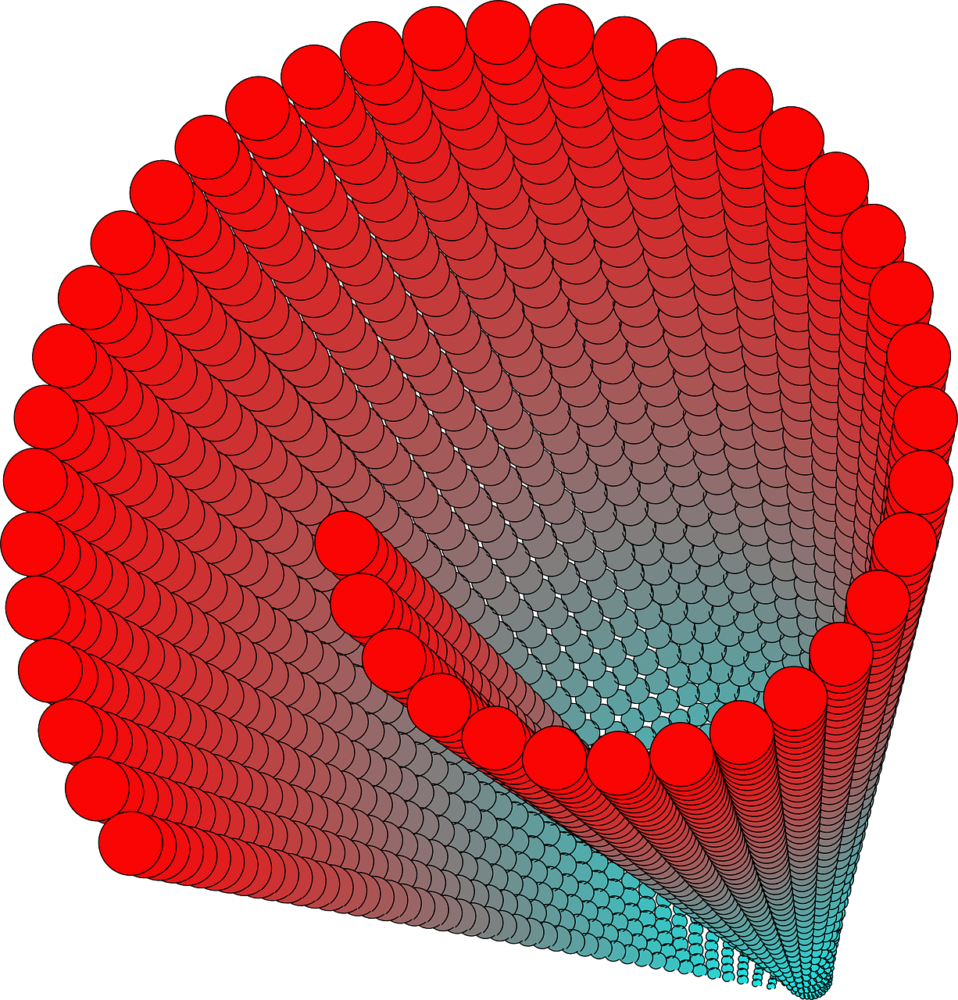Wider die Angst vor der Zukunft
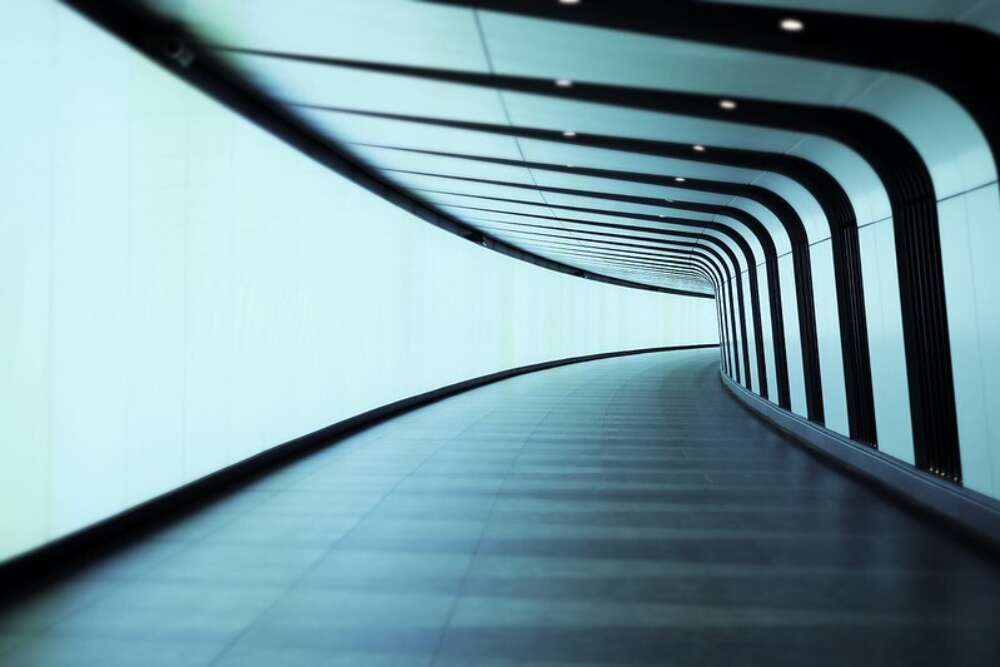
Seit Jahrzehnten wird der deutschen Außenpolitik ein Mangel an Strategiefähigkeit, Gestaltungswillen und Mut attestiert. Immer wieder, so die Diagnose, laufe sie wichtigen Entwicklungen nur hinterher – sei es mit Blick auf die Renaissance der Autokratien, Russlands Demontage der europäischen Sicherheitsarchitektur oder Trump 2.0.
In einer Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung heißt es etwa: Der Regierungsapparat ist gegenwartsfixiert und im Silodenken verhaftet, er strebt stets die Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner an, und es fällt ihm schwer, von bewährten Mustern abzuweichen. Die Zukunftsforscherin und Forschungsdirektorin der NATO Florence Gaub bescheinigt der deutschen Gesellschaft insgesamt Zukunftsangst und erklärt: Wer Angst hat, kann nicht nach vorne denken.
Diese Zukunftsangst ist kaum überraschend: Drei Jahre russische Vollinvasion der Ukraine ohne absehbares Ende. 20 Jahre Afghanistan-Einsatz mit erfolglosem Ende. Die Ampelregierung wollte zukunftsorientiert und vorausschauend handeln, ist aber letztlich gescheitert. Die Zeitenwende in der europäischen Sicherheit kommt nur langsam voran. Demokratien verstricken sich in Widersprüche, Autokratien schmieden Allianzen. Für junge Generationen scheint mit Klimawandel, maroder Infrastruktur und wirtschaftlichem Abschwung auf absehbare Zeit alles noch schlimmer zu werden.
Doch es geht auch anders. Wissenschaftliche Zukunftsforschung kann dazu beitragen, mehr Handlungs- und Strategiefähigkeit zu entwickeln. Ihr Ziel ist es nicht, die Zukunft als passiver Empfänger zu analysieren, sondern Zukunftsängste abzubauen, Gestaltungsspielräume aufzuzeigen und bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Dafür muss die Politik selbst mehr tun – und die Politikberatung kann ihr als Sparringspartner dabei helfen.
Der Trick mit der Vorausschau
Strategische Vorausschau ist angewandte Zukunftsforschung für Entscheiderinnen und Entscheider. Sie versucht nicht, die Zukunft präzise vorherzusagen. Stattdessen wird mithilfe wissenschaftlicher Methoden erforscht, welche Schlussfolgerungen sich aus möglichen Zukünften ableiten lassen, um im Hier und Jetzt bessere Entscheidungen zu treffen und die Zukunft aktiv im eigenen Interesse zu gestalten.
Es geht darum, bestehende Annahmen rigoros zu hinterfragen. Durch das Identifizieren blinder Flecken wird relevante Expertise sichtbar gemacht – unabhängig von Status und Rang. Reine Ideologien, aufgeblähte Egos und unfundierte Argumente verlieren hingegen an Einfluss. Dieses strukturierte, methodische Vorgehen mag mitunter Unbehagen auslösen – es ist aber ein Merkmal guter Vorausschau und Voraussetzung für bessere Ergebnisse.
Eine strukturierte Auseinandersetzung mit der Zukunft ist auch die Grundlage für jede erfolgreiche Strategie – denn Strategien brauchen Ziele, und diese liegen naturgemäß in der Zukunft. Allerdings sind Zukunftsbilder erstaunlich oft unausgesprochen und unterentwickelt. Die menschliche Intuition allein ist bei Zukunfts- und Politikplanung kein verlässlicher Kompass. Strategische Vorausschau hingegen macht Zukunftsbilder explizit und unterscheidet zwischen wünschenswerten und plausiblen Szenarien.
Strategische Vorausschau hilft außerdem dabei, Risiken zu priorisieren, Chancen zu erkennen und resiliente Politikvorhaben zu entwickeln. Sie nimmt sowohl einzelne Trends und Einflussfaktoren isoliert in den Blick als auch deren wechselseitige Verflechtungen. Dabei geht es nicht darum, Unsicherheiten, Widersprüche und Komplexität zu vertuschen. Im Gegenteil: Vorausschau macht diese überhaupt erst sichtbar und handhabbar. Sie wirkt so einer Überforderung entgegen und erhöht die Erfolgschancen politischer Vorhaben – selbst bei komplexen Herausforderungen wie der Klimakrise.
Vorausschauprozesse sind auch geeignet, kritische Fragen zu behandeln, die sonst nie auf die Tagesordnung kommen würden. „Was wäre, wenn Russland den Krieg in der Ukraine doch gewinnt?“ als Diskussionspunkt vorzuschlagen, kann mit hohen sozialen Kosten verbunden sein. Niemand will der Schwarzmaler sein. Ein strukturierter Vorausschauprozess hingegen kann dieses Szenario als kritische und unterbeleuchtete Zukunft zur Diskussion stellen. Der politische Planungsstab der NATO kooperiert beispielsweise mit Thinktanks, um in Vorausschauformaten mit Alliierten und Partnern wichtige, sensible Vorhaben vorsichtig abzutasten.
Darüber hinaus können Vorausschaumethoden dazu beitragen, langwierige Transformationsprozesse zu erleichtern. Explizite Zukunftsbilder machen deutlich, warum unbequeme Veränderungen lohnenswert sind. So berät etwa in Australien der sogenannte Futures Hub des National Security College die Regierung in strategischen Fragen und trägt zu Verwaltungsreformen im gesamten Regierungsapparat bei. Auch in Deutschland können Projekte wie die überparteiliche Initiative für einen handlungsfähigen Staat mit strategischer Vorausschau die Erfolgsaussichten von Reformplänen erhöhen.
Nicht zuletzt kann Vorausschau unter breiter Beteiligung dabei helfen, Politik inklusiver zu gestalten und demokratisch zu legitimieren. Vorausschautechniken wurden beispielsweise eingesetzt, um in Südafrika im Aussöhnungsprozess nach der Apartheid gemeinsame Grundlagen für ein demokratisches Miteinander der Gesellschaft zu erarbeiten. Wenn die Politik dagegen keine Zukunftsbilder anbietet oder diese nur implizit kommuniziert, dann tappt die Wählerschaft im Dunkeln.
Deutschland tut sich schwer
Dort, wo es auf langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit ankommt, leistet man sich professionelle strategische Vorausschau. Das Erarbeiten verschiedener Szenarien für die globale Energiewirtschaft half beispielsweise Shell in den 1970er Jahren, besser als die Konkurrenz auf die Ölkrise vorbereitet zu sein. Nach 9/11 sprachen die US-Geheimdienste von einem „Versagen der Vorstellungskraft“ und diversifizierten daraufhin ihre Vorausschaumethoden. Länder wie Finnland, Kanada, Großbritannien und Singapur haben Vorausschau fest in Regierung, Parlament und Sicherheitspolitik verankert.
Doch Deutschland tut sich schwer. In Ministerien und Behörden leisten einzelne Mitarbeitende und Teams gute Vorausschauarbeit. Dennoch ist die Annahme weit verbreitet, dass traditionelle Methoden und Abläufe es schon irgendwie richten werden. In Anbetracht der Beweislage – also der Ergebnisse der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik der vergangenen Jahrzehnte – kann diese Selbstüberschätzung nur erstaunen.
Die Bundesregierung kann sich nicht mehr auf Warnungen der US-Geheimdienste verlassen – sei es vor Anschlagsplänen oder vor einer russischen Invasion. Der Global Trends Report der US-Geheimdienste ist in der Ära Trump kaum eine gute Planungsgrundlage. Es braucht angesichts einer sich schnell verändernden Bedrohungslage einen professionellen Umgang mit der Zukunft. Ein Zentrum für strategische Vorausschau, das den methodischen Sachverstand hierzulande mobilisiert und in die Politik hineinwirkt, wäre sinnvoll. Die Aufwertung der Vorausschau in sicherheitspolitischen Entscheidungsstrukturen wie einem Nationalen Sicherheitsrat ist dringend nötig.
Die auf Zukunftsforschung basierte Politikberatung kann dem Regierungsapparat wichtige Impulse geben. Statt als verlängerte Werkbank der Verwaltung zu fungieren oder ausufernde Analysen der Vergangenheit zu liefern, bietet sie einen grundlegend anderen Ansatz, der im Zeitalter der Polykrise tiefgreifende Defizite ausgleichen und den Blick auf das Wesentliche lenken kann. Folgende Grundprinzipien sollten dafür leitend sein.
Die Lizenz zum Kritisieren
Wenn Entscheidungsträger nicht bereit sind, sich selbst zu hinterfragen und fundierten kritischen Widerspruch aus ihrem Arbeitsumfeld zu fördern, führt dies zu politischen Fehleinschätzungen. Kritisches Infragestellen von Denkmustern und Annahmen ist der Kern strategischer Vorausschau, vergleichbar mit den strukturierten Analysetechniken in der nachrichtendienstlichen Auswertung. Zukunftsforschung braucht daher die Lizenz zum Kritisieren – sowohl innerhalb des Regierungsapparats als auch von außen.
So kam etwa die erfolgreiche Ausbreitung des sogenannten Islamischen Staates (IS) im Irak für die deutsche Politik überraschend – nicht zuletzt, weil veraltete Annahmen nicht rechtzeitig aktualisiert wurden. Man orientierte sich am Vorgehen von Al-Qaida und verpasste neue Entwicklungen. Informationen, die Beobachtungen aus der Vergangenheit bestätigten, wurde mehr Gewicht beigemessen als solchen, die nicht in das bestehende Schema passten – eine klassische kognitive Verzerrung. Man übersah nicht nur die Bedeutung der Steuererhebung und des Aufbaus von Verwaltungsstrukturen durch den IS in eroberten Gebieten, sondern auch die neuen Wege der Online-Radikalisierung und der Rekrutierung europäischer Staatsbürger für den Dschihad. Deutsche und britische Dienste überschätzten zudem die Fähigkeiten des irakischen Staates – auch deshalb, weil man selbst viel in die Partner vor Ort investiert und sie teilweise persönlich ausgebildet hatte. Die Schwäche der irakischen Sicherheitskräfte anzuerkennen, hätte bedeutet, die eigenen Erfolge – oder gar die der Vorgesetzten – infrage zu stellen. In ähnlicher Weise überwog in der Bundesregierung nach dem Minsk-II-Abkommen die Hoffnung auf den Erfolg der eigenen Verhandlungen mit Russland gegenüber abweichenden Informationen und Einschätzungen, die nicht ernst genommen wurden.
Gute Vorausschauprozesse hingegen nehmen schwache Signale aus unterschiedlichen Quellen ernst. Sie filtern relevante Hinweise heraus, beobachten Entwicklungen und nutzen diese, um Annahmen regelmäßig zu überprüfen. Wenn die Entscheidungsebene allerdings konforme, eindeutige Antworten fordert, kritische Drahtberichte bestraft oder irritierende Meinungen nicht einlädt, dann erhält sie schlechten Rat. Um wirksam zu sein, muss Politikberatung den Mut zur Kritik haben – und in einem Umfeld arbeiten können, das genau dazu ermutigt.
Methodenkompetenz fördern
Vorausschau kann nicht wirken, wenn Thinktanks und Stiftungen „Vorausschau“ auf scheinbar innovative Vorhaben draufschreiben, nur um dann so weiterzumachen wie bisher. Strategische Vorausschau ist kein Hexenwerk. Doch sie erfordert eine stringente Logik, die ihr die Legitimität verleiht, anders zu diskutieren, als es Expertinnen, Beamte und Politiker gewohnt sind. Wer versucht, einen Szenarioworkshop ohne das notwendige methodische Know-how zu moderieren, verstrickt sich schnell in Widersprüche. Das ist bestenfalls nutzlos – und schlimmstenfalls schädigend. Denn wer einmal an einem schlechten Vorausschauprozess teilgenommen hat, verliert oft langfristig das Vertrauen in die Zukunftsforschung.
Möglichkeiten zur formalen methodischen Aus- und Weiterbildung für die Praxis der Politikberatung sind in Deutschland begrenzt. Die Bundesakademie für Sicherheitspolitik bietet ein Grundlagenseminar für Mitarbeitende der Bundesverwaltung an. Der Masterstudiengang Zukunftsforschung an der FU Berlin ist das einzige umfassende universitäre Weiterbildungsangebot. Kommerzielle Anbieter aus dem Ausland sind oft teuer, und hierzulande hat sich eine kommerzielle Beratungspraxis mit geschütztem Wissen erfolgreich eine Nische eingerichtet. Zukunftskompetenz durch formalisierte Ausbildung in der Breite von Unternehmen, Zivilgesellschaft und Thinktanks zu verankern, ist schwierig.
Auch in Ministerien und Behörden behindern das Festhalten an etablierten Ansätzen und die Präferenz für schnelle, einfache Lösungen hilfreiche Vorausschau. Vor diesem Hintergrund sollten politische Praxis, Stiftungen und wissenschaftliche Institute ein Interesse an der Weiterentwicklung der Methodenkompetenz haben und in diese investieren.
Die Forschung zum Erfolg von strategischer Vorausschau in der Außen- und Sicherheitspolitik zeigt, dass Vorausschau zwar ein kritischer Sparringspartner sein sollte, sich aber gleichzeitig an den Bedarfslagen von Entscheidungsträgern orientieren muss, um relevant zu sein. Dazu müssen Politik und Verwaltung bereit sein, sich bis zu einem gewissen Grad – und natürlich vertraulich – in die Karten schauen zu lassen. Es reicht nicht aus, ein Vorausschauprojekt bei einem kompetenten Beratungsteam zu beauftragen und darauf zu hoffen, dass die Ergebnisse per se hilfreich sein werden.
Transparenz ist auch erforderlich, um die Methodik der Vorausschau aufzuwerten. In politischen Runden gibt es die Tendenz, selektiv jene Evidenz heranzuziehen, die die eigene Position oder die des jeweiligen Ministeriums stützt – und den Rest zu ignorieren. So kommt es vor, dass ein hastig verfasstes Szenario einer Einzelperson gleichwertig neben den Ergebnissen eines qualitativ hochwertigen und methodisch fundierten Vorausschauprozesses steht – und sich am Ende nicht die stringenteste Analyse durchsetzt, sondern der charismatischste Redner.
Isolierte Vorausschauprodukte laufen Gefahr, in Routinen des politischen Alltags unterzugehen. Sinnvoller ist es, eine methodische Begleitung des gesamten Prozesses zu beauftragen oder diese intern vorzuhalten – von der Erarbeitung von Analyseprodukten bis zur Moderation der Entscheidungsfindung.
Langfristig denken, frühzeitig handeln
Den möglicherweise größten Einfluss kann Zukunftsforschung haben, indem sie langfristiges Denken ermöglicht. Der Druck des Tagesgeschäfts in der Regierungspolitik wird stets als Hindernis für strategischere Politik angeführt. Die meisten Politikbereiche sind von kurzfristigem Denken in maximal einer Legislaturperiode – eher aber wenigen Monaten – geprägt.
Dies zeigt sich etwa, wenn militärische auf politische Planung trifft: Während das Militär Anforderungsprofile für Streitkräfte mit einem Zeithorizont von bis zu 20 Jahren entwickelt, werden solche Analysen von der Politik häufig als weltfremd oder irrelevant abgetan. Dabei sagt der zeitliche Rahmen einer Analyse nichts über den Zeitpunkt konkreter Maßnahmen aus. So hat die NATO etwa die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels mehrere Jahrzehnte in die Zukunft analysiert, um daraus konkrete Handlungsoptionen für die kommenden Jahre abzuleiten, die bei NATO-Gipfeln verhandelt werden. Das macht Zukunft handhabbarer.
Im geopolitischen Systemwettbewerb heißt es oft, Autokraten seien im Vorteil, da sie nicht an Legislaturperioden gebunden sind. Doch wer sagt, dass sich Parteien in Demokratien im Wahlkampf auf Ideen für die nächsten vier Jahre beschränken müssen? Dass es auch anders geht, zeigt das spanische nationale Büro für Vorausschau und Strategie: Mit dem Projekt „Spain 2050“ wurden parteiübergreifend und unter gesellschaftlicher Beteiligung neun zentrale Herausforderungen für die nächsten Jahrzehnte identifiziert und 200 Handlungsoptionen für eine langfristige, über Legislaturperioden hinausreichende Strategie entwickelt.
Wer brauchbare Szenarien für die nächsten zehn Jahre entwickeln will, muss nach der Zukunft in 15 bis 20 Jahren fragen, denn der Mensch unterschätzt systematisch das Ausmaß der Veränderung in der Zukunft. Gleichzeitig neigt das menschliche Gehirn dazu, selbst dort Zusammenhänge zu erkennen, wo keine sind. Tritt ein Ereignis ein, sortiert das Unterbewusstsein Informationen und Erinnerungen neu und gaukelt uns vor, wir hätten es längst vorhergesehen. Das führt zu überzogenem Vertrauen in die eigene Vorhersagekraft.
Der Zukunftsforscher Joseph Voros empfiehlt deshalb, scheinbar unmögliche Zukünfte nicht außer Acht zu lassen – ganz im Sinne seines Kollegen James A. Dator, der sagte: „Jede nützliche Idee über die Zukunft sollte lächerlich erscheinen.“ Dieser Logik folgend, bezahlt das französische Verteidigungsministerium Science-Fiction-Autoren, um die Zukunft der Sicherheitspolitik zu verstehen.
Für das deutsche Beamtentum mag das verrückt klingen, doch die Rolle der Fiktion in der Zukunftsforschung sollte nicht unterschätzt werden – denn: Am Ende findet die Zukunft in einer Welt statt, die so noch nicht existiert. Die Vergangenheit und die Gegenwart reichen nicht als Grundlage.
Kurzum: Bei der Anwendung strukturierter Analysetechniken und strategischer Vorausschau gibt es im deutschen Regierungsapparat viel Luft nach oben. Diese Gelegenheit kann Politikberatung nutzen, indem sie nicht die gleichen Verzerrungen produziert, sondern andere Zukünfte anbietet, die Ängste nehmen, Menschen motivieren und Entscheidungen langfristig besser machen.
Dieser Kommentar wurde ursprünglich am 30. Juni 2025 in Internationale Politik als Teil einer Sonderausgabe mit dem Titel “Weltendenker. Politikberatung in bewegten Zeiten.”