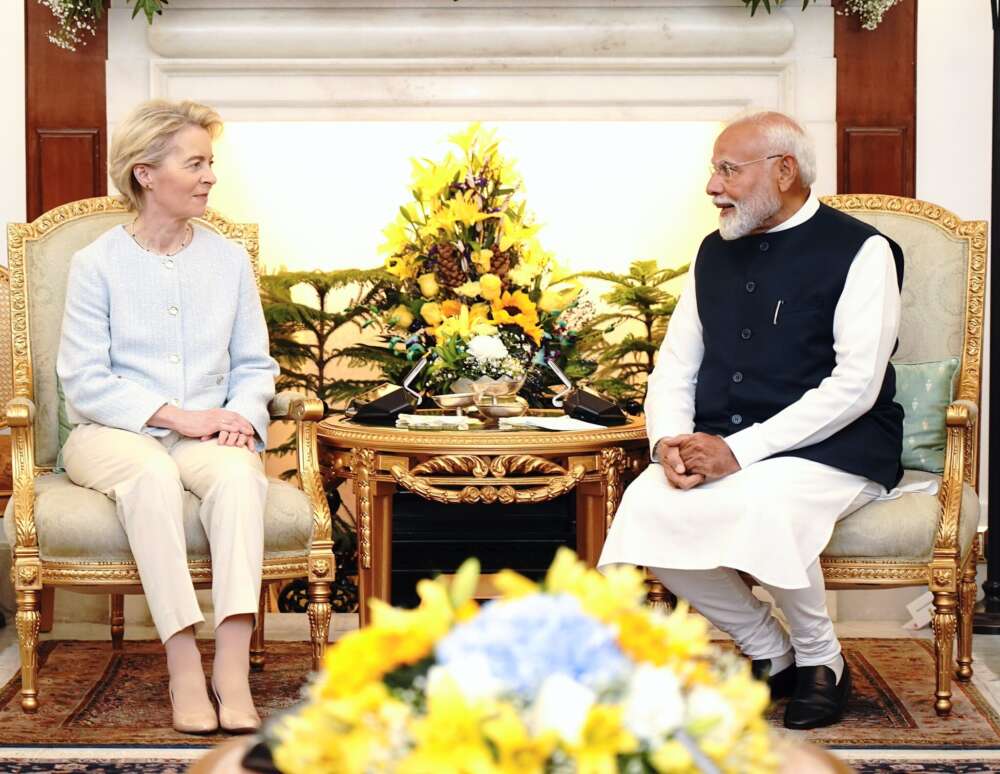Es ist aberwitzig, in China einen verlässlichen Partner zu sehen
„Schmales Gewässer, gefährliche Strömung“ heißt das exzellente Buch zum Konflikt zwischen Taiwan und China, das Friedrich Merz im vergangenen November las. Die Lektüre hallt nach. In seiner ersten Regierungserklärung warf der Bundeskanzler einen ungeschminkten Blick auf Xi Jinpings Großmachtpolitik.
Er spricht von „zunehmenden Elementen systemischer Rivalität“. Mit „großer Sorge“ betrachtet der Kanzler die „wachsende Nähe zwischen Peking und Moskau“. Merz sieht deutlich die sicherheitspolitische Bedrohung, die von Peking als größtem Unterstützer von Putins Kriegsmaschinerie ausgeht. Und kündigt an, Abhängigkeiten von China im Rahmen eines „strategischen Deriskings“ abzubauen.
Mit Johann Wadephul und Jens Spahn sitzen die Architekten der CDU-Abkehr von Angela Merkels Illusionen einer „strategischen Partnerschaft“ mit Peking als Außenminister und Fraktionsvorsitzender an entscheidenden Schaltstellen. Dies lässt auf eine entschlossenere Chinapolitik in der Ära Merz hoffen.
Diese ist auch dringend nötig. „Derisking“ bei europäischen Lieferketten ist bislang vor allem Rhetorik. Es gibt weiterhin massive kritische Abhängigkeiten. Es ist gut, dass sich die Koalition verpflichtet hat, durch eine vom Bundestag eingesetzte Expertenkommission jährlich Verwundbarkeiten zu analysieren und Maßnahmen zum Risikoabbau zu entwickeln.
Scholz gestand Huawei eine starke Rolle zu
Selbst im Bereich kritische Infrastruktur hat Deutschland bislang nicht Ernst gemacht. Merz könnte einen Kurswechsel einleiten, indem er die 5G-Entscheidung von Olaf Scholz aus dem vergangenen Sommer revidiert. Scholz gestand dem Hochrisikoanbieter Huawei nach Druck sowohl von der Deutschen Telekom als auch von China eine starke Rolle im Zugangsnetz zu, obwohl mit Ericsson und Nokia europäische Hochtechnologieanbieter zur Verfügung stehen.
Auch im Energienetz sollte der Kanzler Entscheidungen zum Schutz kritischer Infrastruktur voranbringen. Deutschland sollte sein Stromnetz nicht von China abhängig machen, egal ob durch Wechselrichter bei Solaranlagen oder bei Windkraftanlagen, wo chinesische Anbieter mit unfairen Wettbewerbsvorteilen ohne regulatorischen Eingriff europäische Konkurrenten wie Siemens Gamesa oder Vestas vom Markt zu verdrängen drohen.
Die folgenschwersten Entscheidungen muss Merz mit Blick auf die Handelsbeziehungen mit China treffen. Der Kanzler sollte den Stimmen eine klare Absage erteilen, die seit Jahren eine realistischere Chinapolitik bekämpfen und jetzt eine Annäherung an Peking als Reaktion auf Trumps Handelskrieg gegen Europa vorantreiben. Es ist aberwitzig, wie DIW-Chef Marcel Fratzscher in Peking einen Garanten des Multilateralismus im Welthandel und einen verlässlichen Partner gegen Trump zu sehen.
Im Gegenteil: Die noch größere Gefahr für den deutschen Wohlstand geht von Chinas Wirtschaftsmodell aus, das die Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation missbraucht und auf globale Dominanz in den deutschen Schlüsselindustrien wie Automobil, Maschinenbau und Chemie setzt. Peking spielt dabei nicht nur die Skalenvorteile des riesigen Heimatmarkts, sondern auch die umfassenden Möglichkeiten des autoritären Staatskapitalismus aus, um den eigenen Unternehmen unfaire Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.
Schock für deutsche Kernindustrien
Folge sind nicht nur sinkende Marktanteile deutscher Unternehmen in China, sondern auch die Verdrängung aus Drittmärkten und ohne Gegenmaßnahmen auch aus dem europäischen Heimatmarkt. Der drohende Chinaschock 2.0 für deutsche Kernindustrien steht heute im Zentrum des Systemwettbewerbs.
Als Antwort reichen die alten Rezepte der Wettbewerbsfähigkeit allein nicht aus. Ja, Energiekosten müssen sinken und die Regierung muss überbordender Regulierung dringend Einhalt gebieten. Doch das reicht nicht aus für die nötige Systemwettbewerbsfähigkeit gegenüber Chinas autoritärem Staatskapitalismus.
Neben einer klugen Industrie- und Innovationspolitik, der Förderung von Freihandelsabkommen und der Stärkung des europäischen Binnenmarkts heißt dies auch, flexible Maßnahmen zum Schutz von Schlüsselsektoren vor unfairem Wettbewerb zu ergreifen, sei es durch Ausgleichszölle oder regulatorische Maßnahmen. All dies kann Deutschland nur im europäischen Verbund erreichen, nicht durch nationale Alleingänge.
Schon vor einem Jahrzehnt warnten Chinaexperten vor den schwerwiegenden Folgen von Pekings Plänen zur globalen industriellen Dominanz. Zu lange verließ sich Deutschland darauf, dass deutsche Unternehmen im globalen Wettbewerb bislang immer reüssiert haben.
Jetzt ist die industrielle Entkernung eine reale Gefahr. Trumps gegen die deutsche Industrie gerichtete Politik macht die Lage noch prekärer. Selten stand mehr auf dem Spiel.
Dieser Kommentar wurde ursprünglich im Handelsblatt am 21. Mai 2025 veröffentlicht.