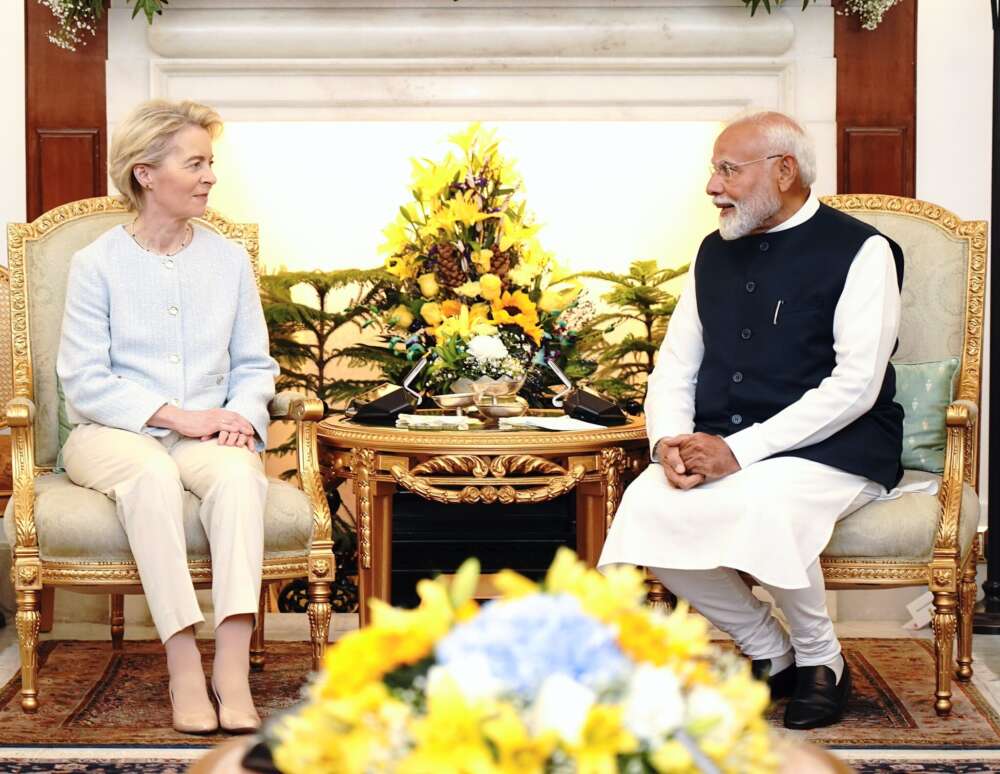Gesundbeten des Status quo reicht nicht mehr: Über die deutsche Nukleardebatte

Vor einem Jahr beschwerte sich der Hamburger Rüstungskontrollforscher Ulrich Kühn über eine von „Panik und Mangel an Expertise“ bestimmte deutsche Nukleardebatte. Es gebe einen anschwellenden Chor von Experten und Entscheidungsträgern, die aus Furcht, von den USA verlassen zu werden, ziemlich panikartige und oft realitätsfremde Politikvorschläge verbreiteten.
Was von interessierter Seite fälschlich als Panikorchester apostrophiert wird, hat nun sozusagen einen neuen Dirigenten. Der künftige Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich und Großbritannien über einen nuklearen Schutzschirm für Europa und Formen der nuklearen Teilhabe sprechen. Frankreich habe diese Frage unter Macron wiederholt an Deutschland gerichtet. „Und sie ist von deutschen Regierungen immer unbeantwortet geblieben.“ Merz will als Kanzler Antworten geben: „Wir müssen darüber reden, wie das aussehen könnte.“
Das ist überfällig. Zu lange haben sich große Teile der sicherheitspolitischen Elite gegen eine solche Debatte gesträubt. Im Dezember 2016, kurz nach der Wahl Trumps, warnte der damalige MSC-Chef Wolfgang Ischinger: „Lasst uns keine Debatte über Nuklearstrategie in Deutschland führen. Das ist gefährlich. Es gibt keine französische oder EU-Option! Unverantwortlich!“ Angela Merkel und Olaf Scholz hielten sich im Kanzleramt an Ischingers Rat. Das 2020 formulierte Angebot des französischen Präsidenten, einen „strategischen Dialog“ über die Rolle von Frankreichs nuklearer Abschreckung zur gemeinsamen Sicherheit zu führen, ließen sie weitgehend ins Leere laufen. Nach dem Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine im Februar 2022 verließ sich Scholz allein auf eine immer engere Partnerschaft mit den USA, auch in Fragen der nuklearen Abschreckung. Er setzte den Kauf von 35 US-Tarnkappenbombern vom Typ F‑35 durch, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe Deutschlands als Trägersysteme für die in Büchel eingelagerten US-Atombomben dienen können. Mit Russlands Krieg änderte sich auch die öffentliche Meinung: Waren 2021 nur 14 Prozent der Deutschen für US-Atomwaffen auf deutschem Boden, wuchs die Unterstützung Mitte 2022 auf 52 Prozent.
Es ist das Verdienst von Olaf Scholz, beherzt die Modernisierung der nuklearen Teilhabe mit den USA erwirkt zu haben. Es ist sein Versäumnis, dass Deutschland in der zweiten Amtszeit Trumps komplett ohne Plan B dasteht. Dies wird von führenden deutschen Stimmen, etwa Generalleutnant a.D. Heinrich Brauß, bis 2018 in NATO-Diensten, schöngeredet. Brauß schreibt, Scholz’ Vorgehen sei verständlich, weil er nicht den Eindruck erwecken wollte, er würde den USA, der NATO und ihren eigenen Beschlüssen zur Abschreckung nicht mehr vertrauen. Mit Blick auf den künftigen Kanzler unkt Brauß: „Ist Merz dabei, die NATO-Abschreckung mindestens zu relativieren – und damit die Gefahr zu provozieren, dass die Trump-Administration dies zum willkommenen Anlass nimmt, aus dem atomaren Schutzschirm auszusteigen und die Europäer auch hier sich selbst zu überlassen?“
Sicher, bei der Diskussion um einen Plan B zur erweiterten nuklearen Abschreckung durch die USA gibt es viele ungelöste Fragen und Risiken. Doch die weit größere Gefahr ist, weiterhin einfach den Status quo zu beschwören, nur weil die Alternativen riskant und schwierig sind. Denn dann stünde Deutschland komplett blank da, wenn Plan A, den niemand leichtfertig aufgeben will, von den USA gekündigt wird. Wenn man sich die Turbulenzen der ersten Monate von Trumps 2.0 ansieht, scheint es unwahrscheinlich, dass der US-Präsident Steilvorlagen von außen braucht, um auf europaschädliche Ideen zu kommen. Die produziert er schon so am laufenden Band. Zwar hat bislang kein US-Politiker die erweiterte nukleare Abschreckung in Zweifel gezogen – bei seiner Rede in Brüssel im Februar beschränkte sich Verteidigungsminister Pete Hegseth explizit auf die Abgabe der Verantwortung für Europas konventionelle Sicherheit. Doch steht bei Trump immer die Gefahr im Raum, dass er die NATO komplett implodieren lässt. Außerdem ist erweiterte nukleare Abschreckung ohne eine beträchtliche konventionelle Präsenz in Europa kaum praktikabel. Wer soll glauben, dass die USA für Tallinn, Danzig oder Berlin Städte wie Boston oder New York durch einen Nuklearschlag aufs Spiel setzen, wenn US-Truppen vorher bei einer konventionellen Eskalation komplett außen vor sind und die USA quasi direkt zum Nuklearschlag greifen würden?
Nötiger Realitätssinn
Die Suche nach einem Plan ist da kein Zeichen von Panik, sondern Realitätssinn. Deutschland und seine europäischen Partner sind damit auch alles andere als allein. Auch US-Verbündete unter US-Nuklearschutzschirm in Asien machen sich ähnliche Gedanken, allen voran Japan und Südkorea. Der Vorteil Deutschlands ist, dass wir noch die Optionen anderer nuklearer Anlehnungsmächte haben. Japan und Südkorea haben dies nicht, weshalb dort die Debatte ohne Umwege zur Frage einer japanischen oder südkoreanischen Atombombe führt. Wir sollten uns also glücklich schätzen, dass wir einen Plan B mit Frankreich (und auch Großbritannien) diskutieren können. Und statt uns wohlig und wohlfeil hinter Argumenten wie „Frankreich kann die USA nicht ersetzen“, „Paris bietet keine nukleare Teilhabe an“ und „Macron will nicht von deutschen Zuschüssen zum Atomprogramm abhängig sein“ zu verschanzen, sollten wir unsere eigenen Ziele für eine nukleare Teilhabe mit Frankreich festlegen und diese mit Paris verhandeln. Dies könnte auch die Schaffung einer Nuklearen Planungsgruppe in Europa unter Beteiligung von zentralen Staaten wie Polen und Italien beinhalten.
Wir müssen dabei in nuklearstrategische Kompetenz investieren, über sehr enge Fachkreise hinaus, sowie im engen Austausch mit Verbündeten, auch in Asien. Und in Ehrlichkeit. Dazu gehört die Erkenntnis, dass eine mit Macron verhandelte Vereinbarung unter dem Vorbehalt der politischen Entwicklungen in Frankreich steht. Sowohl die extreme Linke als auch die extreme Rechte sprechen sich klar gegen jede nukleare Teilhabe Deutschlands aus – und haben gute Chancen bei der Präsidentschaftswahl 2027. Aufgrund dieser politischen Unwägbarkeiten ist Deutschland gut beraten, genauso wie Japan und Südkorea in nukleare Latenz, also die grundlegenden Fähigkeiten für ein nationales Atomwaffenprogramm, zu investieren – natürlich ohne, dass die politische Führung dies offensiv kommuniziert. Ob es im nächsten Jahrzehnt zu nuklearer Proliferation unter US-Verbündeten in Asien wie Europa kommt, hängt zentral von der Position der US-Regierung ab.
Vor zehn Jahren haben die Forscher Monteiro und Debs die strategische Logik der nuklearen Proliferation seziert. Ein schwacher Staat erwerbe wahrscheinlich nur dann Atomwaffen, wenn er einen mächtigen Verbündeten hat, der weder bereit ist, zuverlässige Schutzgarantien zu bieten, noch in der Lage, konsequente Drohungen mit sofortigem Abbruch im Falle eines nationalen Atomwaffenprogramms auszusprechen. Das könnte auf die USA zutreffen, folgen sie den Ratschlägen Elbridge Colbys, von Trump für eine zentrale Rolle im Pentagon nominiert. In seinem Buch „Strategy of Denial“ nennt er die Option „friendly nuclear proliferation“, wenn klar ist, dass die USA die erweiterte nukleare Abschreckung nicht mehr langfristig glaubwürdig aufrechterhalten können. Das wäre dann quasi der letzte Freundschaftsdienst eines müden Hegemons an seinen Verbündeten.
Dieser Kommentar wurde ursprünglich am 28. April, 2025 von Internationale Politik veröffentlicht.